von Marion Fliecker
Hinweise
Anton Mayer
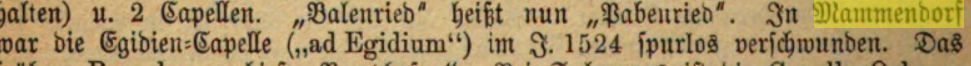
Anton Mayer hat bei der Aufzählung der Pfarreien darauf hingewiesen, dass eine Egidien-Capelle „ad Egidium“ spurlos verschwunden ist. Dies bezog sich darauf, dass diese Kapelle im Sunderndorfschen Matrikel im Dekanat Egenhofen bei Mammendorf nicht mehr genannt wurde.[1] Hier gibt es verschiedene Ansätze, die zur Diskussion gestellt werden sollten.
Egidius – Ägidius (Gilg, Gilles)
Anrufung: Ägidius ist der einzige der vierzehn Nothelfer, der nicht das Martyrium erlitt. Er ist Schutzpatron der stillenden Mütter und der Hirten. Als Beschützer der Bettler und Krüppel wird seine Fürbitte angerufen bei Pest, Aussatz und Krebs, bei Dürre, Sturm und Feuersbrunst, in geistiger Not und Verlassenheit, gegen Fallsucht, Geisteskrankheiten und Unfruchtbarkeit von Mensch und Tier.[2]
Hinweise in: Statistische Beschreibung des Erzbistums München-Freising, Band I von 1874, Anton Mayer
Dekanat Egenhofen, Pfarrei 16 Mammendorf
Es werden bei Mammendorf die Filialen Nannhofen, Peretshofen, Germerswang und als letzte Aufzählung „ad Egidium“. aus den Unterlagen zu den Konradinischen Matrikeln genannt.
Neben der Beschreibung der Kirchen von Mammendorf und den Filialen werden von Anton Mayer auch 2 Kapellen bei Mammendorf genannt, ohne den Namen der Kapellen zu nennen:[3]
1. In Egg: eine kleine Privatkapelle
In einer von Apian 1560 erstellten Karte war eine verhältnismäßig große Kirche oder Kapelle eingezeichnet. Im Jahr 1810 konnte in der Uraufnahme darüber kein Hinweis mehr gefunden werden. Deshalb ging man davon aus, dass die ursprüngliche Kapelle in Egg beseitigt wurde. 1831 hat Marianne Walch aus Egg eine neue Kapelle errichten lassen.[4]
War die ursprüngliche Kapelle in Egg unsere gesuchte Egidius-Kapelle?
2. In Eitelsried eine Feldkapelle
Die Feldkapelle in Eitelsried wird als Kapelle, sogenannte Pestkapelle am Kapellenfeld bezeichnet[5]. Diese Kapelle wurde von Appian in der Karte von 1560 als „Kirche mit einem ungewöhnlich hohen Turm“ eingezeichnet. Die Verfasser des Mammendorfer Heimatbuches bezweifeln, ob dies der Realität entsprach. Die jetzige Kapelle in Eitelsried soll aus dem 17./18. Jahrhundert stammen und dem heiligen Sebastian geweiht worden sein.[6]
Auch hier könnte die Vorgängerkapelle die Egidius-kapelle gewesen sein. Auffällig ist, dass der Ort an dem die Kapelle steht „am Kapellenfeld“ genannt wird – handelt es sich hier um einen alten Flurnamen und bezeichnet somit die Wichtigkeit des Standorts und somit der Kapelle?
Deutung
Galgen – Gilgen?
Die von Uli Bähr genannte Möglichkeit möchte ich auch aufgreifen.
Die Feststellung von Anton Mayer, dass Mammendorf „wohl früh schon eine sehr ausgedehnte Pfarrei, wozu Galgen und Aich gehörten“ war[7], könnte ein Hinweis sein, dass die gesuchte Kapelle auch in Galgen möglich gewesen sein könnte, evtl. mit dem ursprünglichen Namen Gilgen statt Galgen? in In Gilching (Landkreis Starnberg), in einem Ortsteil gibt es die Filiale St. Gilgen mit der Kapelle St. Ägidius[8].
Für Galgen wird allerdings erst ab 1923 eine private Kapelle erwähnt[9]. Eine Kapelle in Galgen oder auch Gilgen wird in den Matrikelbeschreibungen von Anton Mayer nicht genannt. Gegen den ursprünglichen Standort in Galgen spricht auch, dass wenn ein Ort nach dem heiligen Ägidius benannt worden wäre, die Kapelle nicht in Vergessenheit geraten sein kann.
Burgstall Haldenberg
Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass die Kapelle zum Burgstall Haldenberg in Mammendorf gehörte. Die letzten Besitzer von Haldenberg waren Dorothea und Albrecht von Haldenberg, die ihrer Tochter Teile der Rechte von Mammendorf übertrugen. Dorothea von Haldenberg ist 1430 verstorben und vererbte einiges an Grundstücken und Rechten an die Gemeinde Mammendorf[10]
Da der ursprüngliche Besitzer Haldenberg bei Landsberg eine Burg Haldenberg mit Kapelle errichtete, kann davon ausgegangen werden, dass auch in Haldenberg-Mammendorf eine Burgkapelle stand (Burg Haldenberg – Wikipedia). Da die Burg in Mammendorf nicht mehr weiterbetrieben wurde, wird auch die Kapelle knapp 100 Jahre später verfallen sein.
Einschätzung Januar 2024:
Anton Mayer schrieb, dass in Mammendorf die Egidien-Kapelle verschwunden war, sollte man sie auch in Mammendorf suchen. Er hätte sonst in seinen Beschreibungen darauf hingewiesen, dass die Kapelle in Galgen, Egg oder Eitelsried verschwunden war.
Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Kapelle auf dem Haldenberg gemeint war und mit dem ganzen Besitz verfallen ist. Hierzu passt auch die Sage im Buch von Frau Gisela Schinzel-Penth. Die Eheleute Haldenberg gingen zu Besuch zu einer anderen Burg, ihre Dienerschaft war alleine auf der Burg und es brach ein frevelhaftes Treiben aus. Bei einem Unwetter, „wie es seit Menschengedenken keines gesehen hatte“ fürchtete die Dienerschaft die Strafe Gottes und sie versuchten, sich in der Burg zu schützen. Es half aber nichts, mit Blitz und Donner spaltete sich die Burg und versank mit allem in dem entstandenen Loch.[11]
Auflösung des Rätsels um die lt. Anton Mayer verschwundene Egidien-kapelle („ad egidium“)[12] im Jahr 2025
Nach weiterer Recherche komme ich zu folgendem Ergebnis:
Nach dem Heimatbuch Stadt und Landkreis Fürstenfeldbruck von 1963 wurde das heutige Egg (ein Weiler von Mammendorf) im Jahr 1157 noch Ekk,
von kirchlicher Seite her aber St. Ägid genannt [13]. Der Artikel im genannten Heimatbuch wurde von Karl Landes, Archivpfleger für den Landkreis Fürstenfeldbruck geschrieben.
Demnach bezog sich das von Anton Mayer genannte „ad egidium“ und die verschwundene Kapelle darauf, dass die Kapelle in St. Ägid nicht mehr erwähnt wurde.
Wie oben bereits geschrieben liegt das auch daran, dass diese in einer von Apian1560 erstellten Karte, als eine verhältnismäßig große Kirche oder Kapelle eingezeichnet war und im Jahr 1810 in der Uraufnahme darüber kein Hinweis mehr gefunden werden konnte. Deshalb ging man davon aus, dass die ursprüngliche Kapelle in Egg beseitigt wurde.
1831 hat Marianne Walch aus Egg eine neue private Kapelle errichten lassen. Im Heimatbuch Stadt und Landkreis Fürstenfeldbruck wird beschrieben, dass die Marienkapelle mit Liebe gepflegt wird.
Man kann nach den neuen Erkenntnissen davon ausgehen, dass die in der Apiankarte von 1560 dargestellte Kirche/ Kapelle die in Ekk/ kirchlich: St. Ägid/ jetzt Egg war und somit die verschwundene Kapelle ad egidium.
Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Kapelle in Egg stand.
Gegen Haldenberg spricht, dass die Entstehung der Kirche im Oberdorf von Mammendorf, St. Nikolaus (und Silvester) lt. Josef Wolfgang Weigl[14] auf die Haldenberger zurückgeht.
Auch J. W. Weigl erklärt, dass der Weiler Egg seinen Namen nicht von der „dortigen Egidkapelle (jetzt St. Maria)“ bekommen hat, „sondern von dem „ECK-ig“ zulaufenden Ende der offenen Weide gegen den anstoßenden Wald.“[15] Spätestens jetzt steht fest, dass die gesuchte Kapelle an der Stelle der jetzigen Privatkapelle St. Maria stand.
Diskussion zur Bedeutung und Richtungsweisung von „ad egidium“
Im digitalen Archiv Erzbistum München und Freising, Mammendorf ist sind z. B. Haus- und Familienbücher zu finden. Die Einträge, die vom jeweiligen Pfarrer vorgenommen wurden sind in folgender Form wie im Beispiel:
„Ad Gallimann in Oberdorf Nr. 54“ – Das „Ad“ wird jedem Namen vorangestellt. Bedeutung: Zum Gallimann in Mammendorf-Oberdorf, Hausnummer 54. Die Hausnamenbezeichnung mit „zum“ ist weiterhin üblich. Die Verfasserin ist z. B. auf dem Grundstück „zum Tabakschneider“ in Jesenwang.
Wenn jetzt im Text von Anton Mayer steht „Ad egidium“ ist das ebenfalls, entsprechend der damals üblichen Bezeichnung von Orten, Höfen als zum Egidium – oder auch zum Ägid zu übersetzen. Zum Ägid in Egg – Zur Ägidiuskapelle in Egg. Hier ist dann naheliegend, dass wie im Heimatbuch beschrieben von kirchlicher Seite her anstatt von Egg/ Ekk nur von St. Ägid gesprochen wurde.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gidius_(Heiliger) ↑
A. Mayer, G. Westermayer, S. 313 ↑
Heimatbuch Band 2, Die Ortschronik von Mammendorf, Gemeinde Mammendorf EOS St. Ottilien, 2008, S. 156 ↑
(https://www.mammendorf.de/sehenswuerdigkeiten-mammendorf). ↑
Heimatbuch Mammendorfer Bd. 2, S. 157 ↑
A. Mayer, G. Westermayer, S. 316 ↑
https://de.wikipedia.org/wiki/St._%C3%84gidius_(Sankt_Gilgen). ↑
Quelle: Galgen (Maisach) – Wikipedia ↑
Walter Irlinger, Toni Drexler und Rolf Marquardt, Landkreis Fürstenfeldbruck, Archäologie zwischen Ammersee und Dachauer Moos, Konrad Theiss Verlag Stuttgart 2007, Seite 198-200 ↑
Gisela Schinzel-Penth, Sagen und Legenden um Fürstenfeldbruck und Germering, EOS St. Ottilien 1996, S. 155 ↑
Anton Mayer, Westermayer Georg, S. 248 ↑
Landkreis Fürstenfeldbruck Vergangenheit und Gegenwart Heimatbuch, Herausgeber R. A. Hoeppner, Redakteur, Assling – Pörsdorf Obb. Verlag für Behörden und Wirtschaft, 1963; S. 179 ↑
Heimatbuch Fürstenfeldbruck, Geschichte und Leben eines oberbayerischen Kreises, Herausgegeben vom Bayerischen Statistischen Landesamt, Verlag Albert Sighart FFb, 1952,S.279 ↑
Ebd. S. 280 ↑

